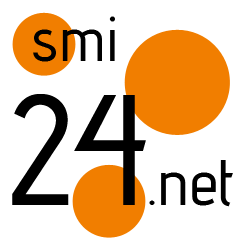Kolumne "Daddy Issues": "Es zerriss mich innerlich und gleichzeitig war ich aufgeregt wie ein Schuljunge"
Sebastian Tigges sehnte sich nach Ruhe und gönnte sich eine kleine Auszeit von seinen Kindern. Welche Erkenntnisse er dabei hatte und was sie mit Mathematik zu tun haben.
Ich bin jetzt seit ziemlich genau dreihundert Wochen Vater. Drei! Hundert! Ich lebe seit ungefähr zweitausendeinhunderteinundfünfzig (2151) Wochen. Damit war ich vierzehn Prozent meines Lebens Vater, Tendenz steigend. Angenommen, ich werde 85 Jahre alt und sterbe dann. Dann wäre ich achtundfünfzig Prozent meines Lebens, also mehr als die Hälfte, Vater gewesen. An meinem einundsiebzigsten Geburtstag werde ich exakt die Hälfte meines Lebens Vater gewesen sein – das sollte ich schaffen und klopfe beim Schreiben dieser Worte dreimal auf den Holztisch unter meinem iPad.
Gemessen an all diesen bemühten Berechnungen erscheinen mir die zwei Wochen, die ich direkt nach Anbruch des neuen, des aktuellen Jahres ohne meine Kinder verbracht habe, recht wenig. Marie und ich vereinbarten im Herbst vergangenen Jahres etwas – für uns – Außergewöhnliches: Wir beide würden uns gegenseitig im Januar 2026 jeweils zwei "freie" Wochen ermöglichen. Für Fernreisen, für Klosterbesuche, fürs effiziente Schreiben, wofür auch immer. Als wir darüber sprachen, gaben sich in meinem Kopf Euphorie und Angst die Klinke in die Hand. Einerseits klang es sehr verlockend, mal für so lange Zeit nur für mich zu sein. Ein absolutes Novum, seitdem ich Vater bin. Bisher war das Längste: eine Woche. Und das auch nur ausnahmsweise. Gleich das Doppelte zu probieren, erschien mir ebenso abenteuerlich wie gewagt, so verführerisch wie tabu.
Endlich mal Zeit ohne die Kinder, oder auch nicht?
Und wir zogen es durch. Einfach so. Ich weiß noch, wie ich die Kinder in der Kenntnis Marie übergab, sie daraufhin so lange nicht zu sehen. Es zerriss mich innerlich und gleichzeitig war ich aufgeregt wie ein Schuljunge vor einem Ferienlager das erste Mal ohne Eltern. Und sie fehlten mir jeden Tag. Anfänglich telefonierten wir noch täglich, doch nach einer Woche kaum noch. Es gab einige Momente, in denen ich innehielt, seufzte und mich der Traurigkeit hingab. Und es gab Tage, an denen ich mich abends dabei ertappte, dass ich den Tag über wenig an sie gedacht hatte. Und sofort klopfte das schlechte Gewissen an meine Tür. Ich machte nicht auf. Ich redete mir selbst gut zu: dass es in Ordnung ist, mich mal eine Zeit um mich selbst zu kümmern, dass es ein großes Geschenk ist, das tun zu können, während viele Eltern sich nach einer solchen Auszeit sehnen. Und das schlechte Gewissen verschwand, wer aber vor der Tür stehen blieb, war die Ambivalenz. Diese grausame, dauerpräsente Erfahrung! Sie hat so viele Gesichter, so viele Masken im Repertoire. freudiges Grinsen bis rot verquollene Augen, alles dabei.
Ich erlebe seitdem ich getrennt erziehender Vater bin, so viele Emotionen, durchlebe an einem Tag so viele Aggregatzustände, mir wird es mitunter ganz schwindelig davon. Das Jahr seit der Trennung, es ist nun ein Jahr her, war das härteste und zugleich lehrreichste Jahr meines Lebens. Die Ambivalenz der Gefühle, die ich seit meiner Vaterschaft stärker als je zuvor erlebt habe, hat in diesem Jahr nochmal um den Faktor 3000 zugenommen. Und es hat mich trainiert, diese Ambivalenz nicht nur auszuhalten, nicht bloß hinzunehmen, sondern wertzuschätzen wie einen treuen Freund, den man oft nicht leiden mag, wenn er einem mal wieder die Meinung sagt, an dem man aber festhält, weil man weiß, dass er recht hat.
Lernen zu vermissen
Da ich es nicht lassen kann, rechne ich, beziehungsweise rechnet die KI für mich noch fix aus: Zwei Wochen sind in etwa 0,67 Prozent meiner bisherigen Zeit als Vater. Nun könnte man sagen: Das ist wenig, sehr wenig. Ich halte dagegen: Es ist beinahe 1 Prozent. Beinahe ein Hundertstel meiner gesamten Zeit als Vater habe ich gerade mal so nebenbei ohne meine Kinder verbracht. Das ist nicht so wenig. Menschen schrecken vor operativen Eingriffen zurück, weil die Mortalitätsrate in vergleichbaren Sphären liegt. Ich habe eine von Hundert Einheiten mit meinen Kindern freiwillig weggegeben. Unerträglicher Gedanke. Zum Glück rettet mich der Gedanke, dass sich das am Ende ausgleicht, weil ich die zwei Wochen danach mit ihnen verbringen darf. Puh, Glück gehabt. Oder doch nicht?! Am Ende kommt jede Rechnung auf das gleiche Ergebnis: die Hälfte. Die Hälfte der Zeit sehe ich meine Kinder. Und die andere Hälfte sehe ich sie nicht. Beide Seiten der Gleichung stehen dort an der Tafel meines neuen Lebens und springen mich an, mal lachend, mal niedergeschlagen.
Mir bleibt nichts anderes übrig, als diese neue Lehre meines Lebens zu verinnerlichen und mit ihr umzugehen. Und mir – ausnahmsweise positiv – meinen Mathematiklehrer in Erinnerung zu rufen, der mir nach einem gescheiterten Versuch, in einer Klassenarbeit bei meinem Sitznachbarn abzuschreiben, unter das rote "mangelhaft" schrieb: Es zählt nicht nur das Ergebnis, sondern auch der richtige Weg zu diesem. Für mich bedeutet das, dass ich versuchen möchte, es auszuhalten, meine Kinder zu vermissen, wenn sie nicht bei mir sind, und es ebenso zu akzeptieren, dass ich meine Kinder nicht immer vermisse, dass ich es sogar genießen darf, wenn sie nicht bei mir sind. Denn alles andere führt vor allem dazu, dass ich weder die Zeit ohne noch die Zeit mit ihnen bestmöglich nutze. Und mir bleiben in meinem Leben, wenn ich Glück habe, nur noch etwa zweitausend Wochen.